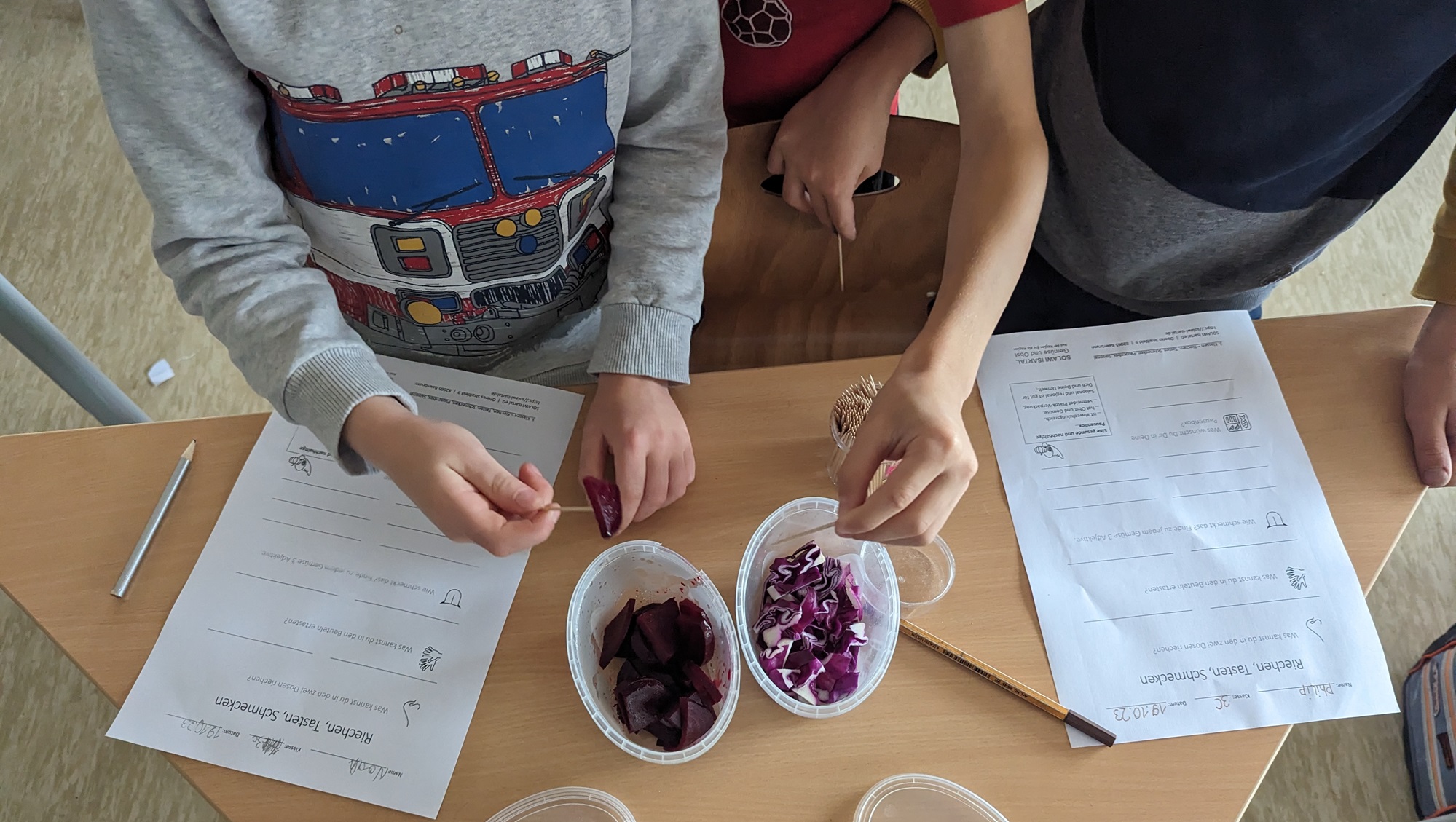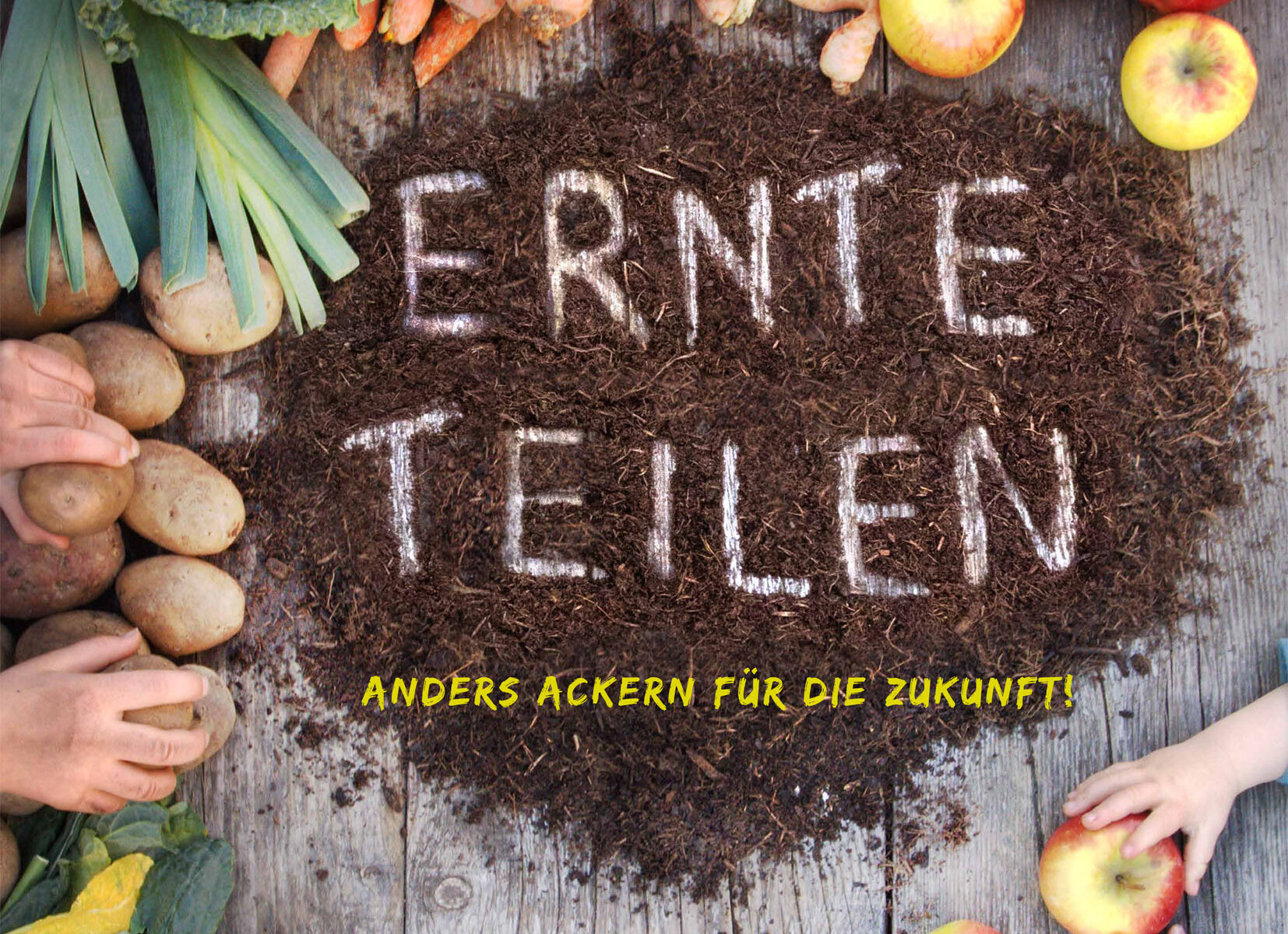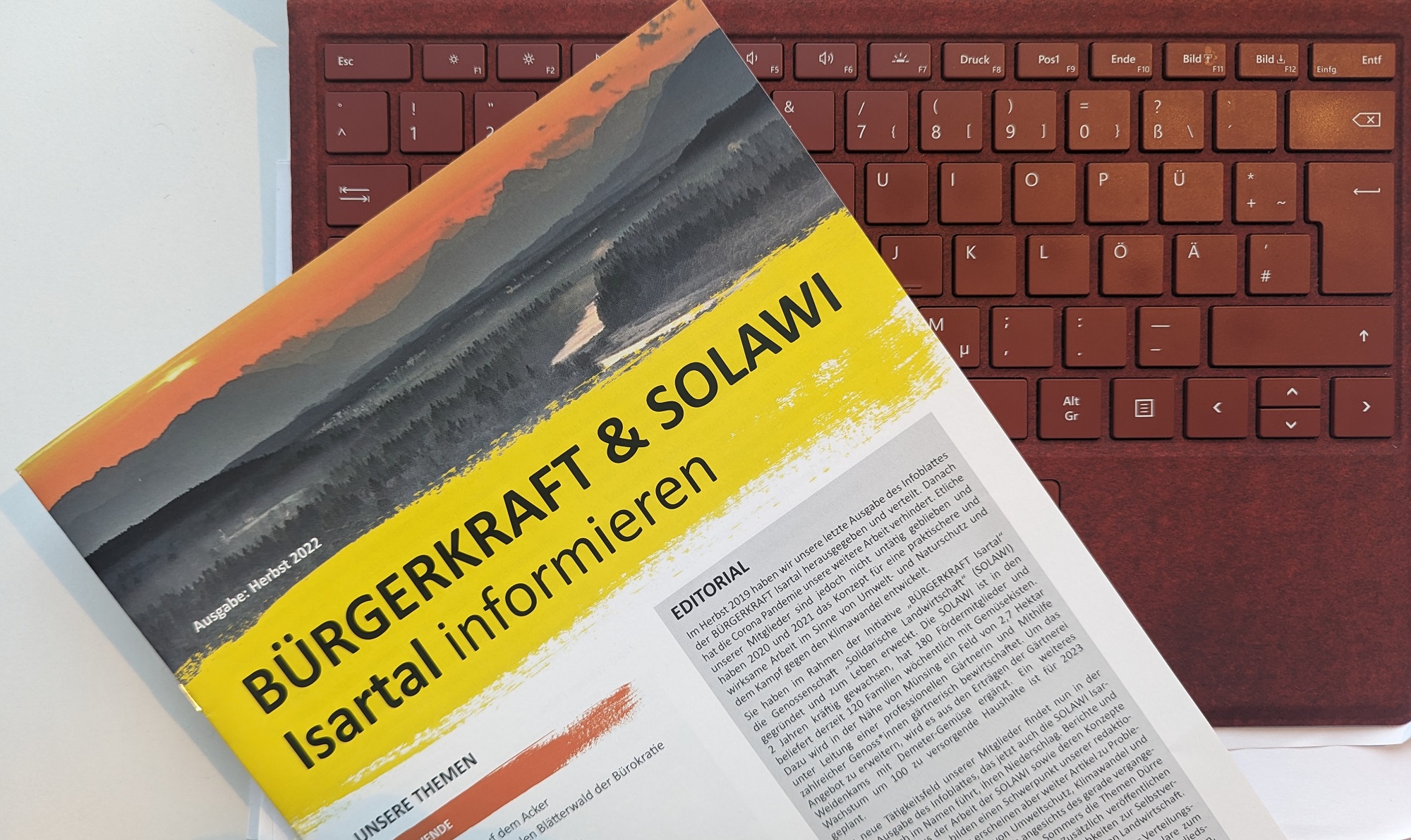Ackerführung zusammen mit dem Vogelexperten Manfred Siering (BUND Naturschutz, Grünwald)
Auf dem SOLAWI Isartal-Acker wird nicht nur Gemüse produziert, sondern durch unterschiedliche Maßnahmen die Artenvielfalt von Vögeln, Insekten, Würmern und Mikroben gefördert. Der weithin bekannte Ornithologe und engagierte Naturschützer Manfred Siering gab uns am Samstag, 28.10.2023 einen Einblick in die Bedeutung regenerativer Landwirtschaft für die Vogelwelt.
Rund 40 Besucher tummelten sich auf dem sonnigen Acker mit bestem Blick auf die Alpen. Nicht sofort erspäht man die scheuen Vögel, doch wer Augen und Ohren offen hält und sich auf die Umgebung einlässt, sieht und hört es plötzlich auffliegen, zwitschern, rufen, spähen, gleiten… Der Vogelkundler Manfred Siering führte über das Feld, ließ die Besucher durch sein Fernrohr spähen und erzählte anschaulich und abwechslungsreich über die Vogelwelt, ihre Herkunft, ihre Beobachtung, über die Zusammenhänge mit der umgebenden Fauna und Flora und kannte jedes Kraut und jedes Mäuschen mit Vor- und Nachnamen.
Und tatsächlich schwirrten die Goldammern in Schwärmen über unsere Köpfe, der Mäusebussard umkreiste uns, die Bachstelze eilte im schnellen Bogenflug Richtung iberischer Halbinsel und der Turmfalke spie sein Gewölle auf der Sitzstange aus und flog dann scheinbar erleichtert zur nächsten Jagd. Nur der Rotmilan, der sonst unsere Felder überfliegt, ließ sich diesmal nicht blicken.
Was die Vögel am Acker der SOLAWI Isartal schätzen ist das reiche Speiseangebot. So picken sie Körner aus den Blumen und naschen an Kräutern, finden ein reiches Buffet an Insekten und Würmern und jagen spektakulär nach den Wühlmäusen, die unsere Rüben anknabbern. In Hecken und Bäumen, die das Feld säumen, finden sie bald auch ausreichend Nistplätze und Verstecke. Auch die Steinhaufen der Lesesteine dienen als Wohnraum für Eidechsen und andere Amphibien. So soll auf dem Acker ein ökologisches Gleichgewicht entstehen. Wir profitieren davon, da wir keine Pestizide einsetzen müssen, um trotzdem eine gute Ernte ohne Knabberstellen einfahren zu können. Na und schöner, ist es auf einem lebendigen Acker sowieso.
Text: Eva-Maria Weigell